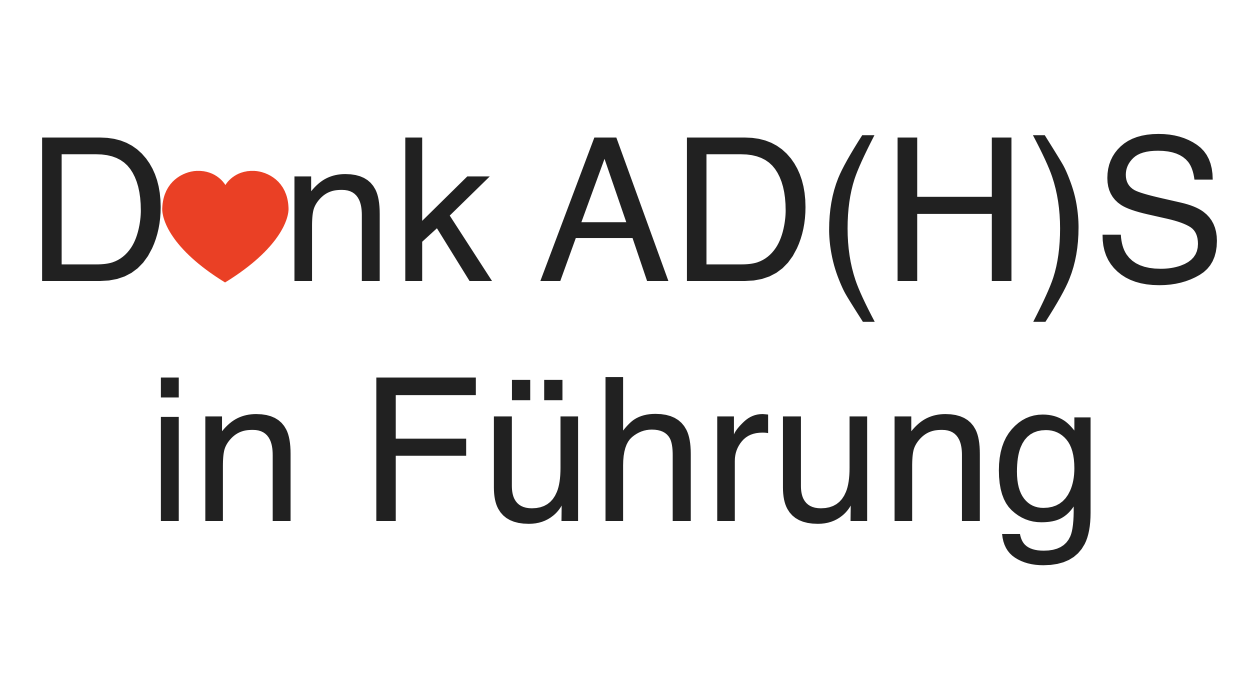Es wird analysiert und festgestellt, es wird nachgedacht und kreativ gebrainstormt, es werden Ideen geprüft und fein geschliffen, es wird vereinbart (hoffentlich!) und mit der Umsetzung begonnen (auch hoffentlich!). Doch dann verlaufen die Aktivitäten im Sande. Schleichend geht gar nichts mehr voran. Und bald schon weiß niemand mehr so recht, was eigentlich erreicht werden sollte. Sehr sehr schade. Doch sehr sehr häufig. Fast schon üblich. Veränderungen haben nur Erfolg, wenn die Umsetzung identisch akribisch und konsequent erfolgt wie das Aufspüren von Verbesserungspotenzialen oder Innovationsdefiziten.
Konsequenz folgt immer einer Logik
Echte, wirksame Konsequenz entsteht nicht einfach aus dem Nichts. Sie ist immer eine Ableitung aus höheren Werten (siehe unten) und klar formulierten Zielen. Demnach ist sie immer von Logik begleitet. Logik hilft aufeinander aufbauende Abfolgen zu gestalten. Diese Abfolgen folgen Zielen, sind prüfbar und können bei nötigen Anpassungen systematisch korrigiert werden. Logik ist also Voraussetzung um Konsequenzen wirksam werden zu lassen. Befindlichkeiten, unpassende Vorlieben oder überkommene Verhaltensmuster können so umgangen bzw. wertschätzend in neue, zielführende Verhaltensweisen gewandelt werden. Werden dann Erfolge erzielt, ist ein leichteres dauerhaftes Umlernen und Etablieren von neuen Erfolgsmustern möglich.
Ohne Logik keine Konsequenz.
Konsequenz unterstützt die Rolle: Führung wird vorhersehbar und erzeugt Vertrauen
Damit hilft echte Konsequenz die eigene berufliche Rolle professionell auszufüllen. Es gilt dann ein „Was brauchen wir hier?“ und kein „Ich will…!“. So ist die nötige Selbstdistanz zu seinen Aufgaben und der Rolle an sich gewährleistet, was strategisch kluge Entscheidungen weitaus möglicher macht, als mit unbewussten emotionalen Verstrickungen. Das Agieren aus der Rolle trägt nicht nur zum Gleichklang von Führung über alle Hierarchiestufen hinweg bei. Denn es wird nach Bedarf und zum Wohle der Gemeinschaft entschieden und nicht nach persönlichen Befindlichkeiten. Es ist auch Selbstschutz, da die Rolle nun einmal auszufüllen ist. Zweitrangig ist, welche Person die Rolle ausfüllt. Deshalb kann mit geringerer persönlicher Verstrickung entschieden und gehandelt werden: „Wäre ich heute krank, würde meine Vertretung ebenso entscheiden. Nicht, weil ich das so will, sondern weil alle Führungskräfte so entscheiden würden.“
Führung wird so vorhersehbar. Das erzeugt Vertrauen.
Konsequenz erzeugt Ruhe, Kraft und Vertrauen.
Echte, weil logische Konsequenz…
…folgt der Integrität
Jede Gemeinschaft funktioniert dauerhaft nur mit gemeinsamen Zielen, Normen und Regeln. Diese können jedoch auf die unterschiedlichste Weise erreicht oder umgesetzt werden. Werte sind Anschauungen, wie wir unser Leben und damit das Miteinander gestalten wollen. Auch das gemeinsame Verständnis, wie welcher Wert zu verstehen ist und wie er gemeinsam lebendig gehalten wird, ist dabei auszuhandeln. Integrität ist das Handeln entsprechend dieser Werte. Unser Handeln richtet sich also an höheren Zuständen aus, die mit dem gemeinschaftlichen Schaffen und Wirken erreicht werden sollen. Damit erreicht Handeln immer ein Mindestmaß an Logik. In der Gemeinschaft entsteht ein WIR-Gefühl, weil alle zu jedem Zeitpunkt wahrnehmen: „Wir ziehen alle an einem Strang!“ Es ist ein Ausdruck von Konsequenz, wenn das Handeln nach den eigenen Werten täglich zur Richtschnur wird. Alle Handelnden können sich gegenseitig unterstützen, korrigieren und Orientierung geben. Konsequentes Handeln wird zum selbstverständlichen Verhaltensmuster.
…erzeugt Vertrauen
Wenn wir wissen, was wir erwarten können oder was auf uns zu kommt, können wir uns dafür rüsten, damit abfinden, uns darauf freuen oder eben auch das Weite suchen. Jedenfalls sind die Verhältnisse klar. Nur, wenn wir mit logischen Abfolgen rechnen können, lernen wir zu vertrauen. Verhalten wir vorhersehbar. Dies gepaart mit gemeinsam gelebten Werten erzeugt Vertrauen.
Unlogische Konsequenz
Fühlen sich Konsequenzen besonders anstrengend oder unbehaglich an? Erzeugt konsequentes Handeln emotionale Betroffenheit oder Widerstand oder ist das Vorgehen erkennbar anfechtbar? Dann erleben wir zwar Konsequenz, doch sie ist nicht direkt aus ursprünglichen Vereinbarungen abgeleitet. Vereinbarungen kommen nur zu Stande, wenn es zuvor entweder Konsens oder Entscheidungen gibt. Maßnahmen, die diese Vereinbarungen Wirklichkeit werden lassen sollen, müssen logisch sein. Sonst sind sie unsinnig und damit unnötig.
Fixierte Konsequenz
Wir machen auch eine Form der Konsequenz aus, die wir mit „fixiert“ beschreiben können. Es ist das verbissene, verbohrte, starrsinnige, engstirnige, rücksichtslose, harte und radikale Umsetzen von einmal Vereinbartem. Ohne Maß und Ziel wird durchgeboxt, was einmal entschieden wurde. Sinnvolle Anpassungen, die konsequent das zu erreichende Ziel im Fokus haben, werden nicht nur nicht vorgenommen. Sie können gar nicht gesehen werden.
Unlogische oder fixierte Konsequenz erzeugt Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Vertrauensverlust
Die Führung gibt die Qualität der Konsequenz vor
Alle im Unternehmen orientieren sich immer nach oben. Was dort vorgelebt wird gilt. „Der Fisch stinkt vom Kopfe“ oder „Wie der Herr so das G´scher“ sind uralte Beobachtungen. Sind Führungskräfte mit der Qualität der vorgelebten Konsequenz untereinander nicht einverstanden? Nun, dann gilt es hier konsequent zu sein und konsequent zu vereinbaren, wohin es geht und was demnach gilt.
Niemals der Härte willen hart sein!
Härte ist niemals konsequent und niemals sinnvoll, weil sie nicht logisch ist. Härte ist zerstörerisch. Oftmals, so beobachte ich, ist mit „Härte“ Konsequenz gemeint. Doch wird der Begriff „Härte“ gewählt, um die Klarheit einer Handlungsweise zu beschreiben.
Zur Verdeutlichung: Härte will hart sein, demnach Leid erzeugen. Erst wenn das Gegenüber offensichtlich leidet, beginnt Härte sich zu entfalten. Hat der Leidende einen belegbaren Nutzen von dieser Härte?
Wenn JA, ist die Härte eine Form der Konsequenz. Sie endet, wenn der Nutzen erfüllt ist oder die Behandlung beginnt schädigend zu werden. Beispiel: ein Profi (-sportler, -musiker, -wissenschaftler, -fachmensch usw.) wird für einen Außenstehenden in bestimmten Situationen „unglaublich hart zu sich selbst sein“. Das ist ein Irrtum. Ein echter Profi weiß, wann in welcher Intensität er in die tiefe Leistung gehen muss, um sich zu verbessern oder bestimmte Erfolge zu erzielen. Der „Nicht-Profi“ weicht an diesen Punkten vor der Belastung aus und wird auch deshalb einen höheren Grad an Expertise nicht erreichen können.
Wenn NEIN, wird Härte nur ihrer selbst willen angewandt. Sie wird weiter angewendet, bis der Behandelte daran zerbricht oder der Behandler Genugtuung spürt. Ja, wir sprechen hier von einem Gefühl, denn der Behandler handelt nach Ideologien, vermuteten Befehlen und Stimmung. Das muss so sein, sonst gäbe es eine logische Anforderung wie die Behandlung zu erfolgen hat. Wobei wir wieder im oben genannten Bereich der Konsequenz wären. Ist die Behandlung so gestaltet, dass sie in jedem Fall den Behandelten schädigt, ist es Folter oder sogar Hinrichtung. Sie wäre dann auch konsequent, wenn es eben in einem Rechtssystem geschieht, das so mit Delinquenten verfahren will.
Härte erzeugt Haß.
Konsequenz fühlt sich durchaus hart an
Nur weil etwas logisch ist, ist es nicht zwangsläufig angenehm. Das wird gerne verwechselt. Um besondere Ziele zu erreichen ist Selbstregulation, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Belohnungsaufschub, Selbstwirksamkeitserwartung usw. unabdingbar. In diesen Dingen braucht es ein gewisses Niveau und Routine. Diese Eigenschaften können gelernt und verbessert werden und bedürfen auch der Pflege. Sind wir darin jedoch routiniert, empfinden wir konsequentes Vorgehen nicht als Einschränkung oder gar Verlusterleben. Diese Empfindungen drehen sich vielmehr um. Es fühlt sich gut an, etwas jetzt gerade nicht zu tun oder zu bekommen. Denn wir wissen, wozu dieser „Verlust“ dient. Nämlich einem ungleich höheren Gewinn. Ja, wir nehmen dieses Tun sogar als Gradmesser und Orientierung für unsere Wegtreue.
Scheinharmonie entsteht durch Inkonsequenz, Harmonie durch Konsequenz
Harmonie entsteht nur durch Klarheit. Und Klarheit bedeutet die Dinge auszusprechen wie sie sind, zu seinen Ansichten und Bedürfnissen zu stehen, sein Handeln nach höheren Werten und Zielen auszurichten. Auf den Punkt gebracht: sich treu bleiben. Sich selbst als Person und als Gemeinschaft ebenfalls sich selbst. Das bedeutet Diskussion und Kampf um die beste Lösung. Das bedeutet andere echt anzunehmen und sie als Partner auf Augenhöhe zu begreifen. Harmonie ist niemals direkt erreichbar. Sie ist ein Ergebnis. Und sie ist niemals ein Dauerzustand. Harmonie, also das In-Einklang-Sein, ist immer wieder neu zu erreichen. Es ist ein aufeinander einlassen und seinen Platz finden. Wie in einem harmonischen Orchester: da gibt es klare Regeln und Rollen. Alle lassen sich auf ein gemeinsames Ziel ein und bemühen sich „in Harmonie“ zu kommen. Also in einen gemeinsamen Zustand zu gelangen der etwas erzeugt, das „wie aus einem Munde“ kommt: Harmonie. Und diese Harmonie ist bei jedem Musikstück, bei jeder Probe, jedem Auftritt immer wieder neu anzustreben und erfordert Arbeit von jedem Einzelnen.
Gutes Delegieren ist konsequentes Delegieren
Soll Delegieren sich nicht in Scheindelegieren verlieren oder in Rückdelegieren auflösen, sind attraktive, Prestige trächtige, ja adelnde Aufgaben zu übergeben. Dies nicht aus einer Not heraus, sondern aus dem konsequenten Verfolgen von strategischen Aufgaben. In den strategisch wichtigen Projekten und Kunden liegt die zukünftige Berechtigung am Markt. Diese haben weitreichende operative Aufgaben zur Folge, die unmittelbar an die geeigneten Fachkräfte delegiert werden. Strategische Arbeit ist mühsam, von Längen geprägt und zeitigt oft erst mittel- bis langfristig Erfolge oder Misserfolge. Das hält nicht jeder Führende ohne Weiteres aus. Es die notwendige Verwandlung von der Fachkraft zur Führungskraft, die in der strategischen Kunst ihre Vollendung findet. So schließt sich der Kreis aus konsequenter strategischer Arbeit der Führungskraft, delegieren der daraus folgenden operativen Aufgaben und dadurch erweiterter Möglichkeiten für den strategischen Fokus. Folglich ist. jede und jeder an seinem Platz, in seiner Rolle und bringt dort seine Leistung.
Daran erkennen wir konsequentes Handeln einer Führungskraft:
- Es gibt eine klare Ausrichtung: diese wird konsequent verfolgt, sie ist jeder Person im Team wohl bekannt.
- Jedem im Team ist die Funktion und Haltung der Rolle des Teams bekannt: „Wir wissen wofür wir Verantwortung übernommen haben.“
- Jedem im Team ist seine Rolle in Funktion und Haltung bekannt: „Ich weiß, wofür ich Verantwortung übernommen habe.“
- Destruktivität wird nicht toleriert, sondern konstruktiv verwandelt in: „Was willst du mit deinem Handeln erreichen? Ist dies ein geeigneter Weg um dort hin zu gelangen oder gibt es bessere Wege?“
- Inkonsequentes Verhalten wird nicht toleriert.
Ist nicht Empathie ein Widerspruch zur Konsequenz?
Empathie ist die Voraussetzung für Konsequenz. Konsequenz bedeutet nicht Kadavergehorsam: Stumpf etwas umsetzen, das irgend jemand vorgegeben hat. Will ich heraus finden, was wirklich wesentlich ist für den gemeinsamen Fortschritt, ist Empathie schlicht die Grundhaltung die ich einnehmen muss, um an die Kerne des zukünftigen Erfolges zu gelangen:
- Was „sehen“ meine Leute?
- Woran „glauben“ meine Leute?
- Was erkennen sie als wesentlich und unabdingbar aus ihrer individuellen Warte heraus?
- Welche Erfahrungen haben sie gemacht?
- Wovon sind sie überzeugt und weshalb?
- Welche Erfolgsmuster haben sie?
- Wo sehen sie sich selbst in Zukunft?
- Was „juckt“ sie so richtig? Wieso genau?
- Was wollen sie hinter sich bringen?
- Worum kreisen sie wie die Katze um den heißen Brei?
- usw.
Der erste Schritt, um mit einem Team, einer Gemeinschaft eine neue gemeinsame Stoßrichtung heraus zu finden oder eine bereits bestehende zu aktualisieren, ist Kreativität. Ist Freiraum für´s Denken. Ist innerer Dialog eines jeden Einzelnen. Ist wogendes aufeinander Eingehen und Einlassen. Ist Spinnerei – denn vom Unmöglichen kommen wir zum Möglichen. Der Wahnsinn ist auch nur einer von vielen Spiegel der Realität. Ist extrahieren des Wesentlichen, des alles Entscheidenden. Erst wenn wir das geschafft haben, macht es überhaupt erst Sinn, die nötigen Schritte der Umsetzung zu planen und dann konsequent an der Umsetzung zu arbeiten.
Konsequenz erzeugt einen geschützten Vertrauensraum sich einzulassen auf das was gilt.
Und es gilt, was allen nützt.
Vergesst die Party nicht!
Belohnung muss sein! Eine Gemeinschaft profitiert auf vielfältige Weise, wenn sie miteinander feiert:
- Die geplante Feier nach gemeinsam durchgestandener anspruchsvoller Zeit ist ein motivierender und bereits vorab belohnender Fixpunkt.
- Schon immer haben Menschen nach vollbrachter Arbeit miteinander gefeiert: Gemeinsam Arbeit planen und durchführen. Sich dabei verausgaben und auch mal in die Haare bekommen. Den Ertrag miteinander stolz für die Zukunft sichern (einlagern). Und dann durchschnaufen und sich wieder miteinander vertragen.: „Puh! Geschafft! Samma wieder guat. “
- Sehr wertvoll für unsere individuelle und kollektive Psychohygiene: das gemeinsame Ritual der Entspannung und des Rückblicks: „Was wir alles geschafft haben!“
- In unserer Nonstop-Welt mit nur wenigen nennenswerten kollektiven Feier-Zeiten wie Weihnachten und Ostern, müssen wir aktiv „Stop – das müssen wir feiern!“ Sagen. Sonst geht es unter.